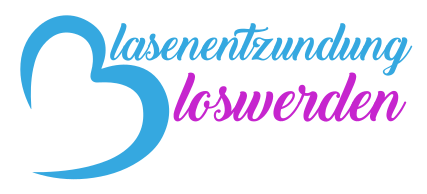Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Blasenentzündungen und Problemen mit der Schilddrüse?
Die Antwort ist nicht einfach und auch nicht offensichtlich, insbesondere da eine Blasenentzündung ein multifaktorielles Problem darstellt, das von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Es ist jedoch möglich, eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Schilddrüsenerkrankungen und wiederkehrenden Blasenentzündungen festzustellen.
Schilddrüsenfunktionsstörungen (Hypothyreose): Auswirkungen auf die Sexualhormone
Das erste Element, um zu verstehen, was Schilddrüse und Blase verbindet, ist die Wechselwirkung zwischen der Schilddrüsenfunktion und der Produktion, Zirkulation und Verfügbarkeit von Sexualhormonen.
Nehmen wir zum Beispiel die Hypothyreose. In diesem Fall spielen zwei Mechanismen eine Rolle: die Produktion von Östrogenen durch die Eierstöcke (a) und die Verfügbarkeit dieser Östrogene für den Körper (b).
- Die Schilddrüse stimuliert den Hypothalamus, um die Produktion von Hormonen zu induzieren, indem eine Reihe von Kettenmechanismen aktiviert wird. Die Hormone sind entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion des endokrinen Systems, das eine wesentliche Rolle bei der Regulation der Eierstockfunktion spielt. Bei Hypothyreose sind die von Hypothalamus an die Eierstöcke gesendeten Reize reduziert, und folglich wird die direkte Produktion von Östrogenen abnehmen. Dies wird als sekundärer Östrogenmangel bezeichnet.
- Die Schilddrüse reguliert auch die Produktion des Proteins SHBG (Sexualhormon-bindendes Globulin); es dient dazu, Östrogene zu transportieren, die nicht frei im Blut zirkulieren können (sie verwenden dieses Transportmittel, um sich zu bewegen und bioverfügbar zu sein). Bei Hypothyreose ist die Produktion dieses Proteins geringer und die Verfügbarkeit zirkulierender Östrogene entsprechend reduziert.
Diese Veränderungen der normalen Physiologie schaffen eine Situation, die als „Östrogenmangel“ zusammengefasst werden kann.
Auswirkungen auf die Sexualhormone (Östrogenmangel): Trockenheit und Verlust des Trophismus der Vulvovaginalschleimhaut
Wie bereits bei der Menopause und der Empfängnisverhütung erwähnt, führt ein Östrogenmangel (produziert oder zirkulierend) häufig zu urogynäkologischen Störungen aufgrund des Verlusts der Stimulation des Trophismus und der Entwicklung (eine Rolle, die Östrogene bei einem normalen Gleichgewicht spielen). Die Abnahme der hormonellen Stimulation führt zu einer Veränderung der Vulvovaginalschleimhaut, die allmählich an Feuchtigkeit, Elastizität und Heilungsfähigkeit verliert.
Auswirkungen auf die Sexualhormone (Östrogenmangel): Ausdünnung der Döderlein-Flora
Die Verringerung der Unterstützung durch Sexualhormone führt parallel zu den Veränderungen der Schleimhaut zu einer Veränderung der Döderlein-Flora, die abnimmt und ihr natürliches Gleichgewicht verliert, was zu sogenannten vaginalen Dysbiosen führt.
Auswirkungen auf die Sexualhormone (Östrogenmangel): Verlust von Trophismus und Empfindlichkeit des Urothels
Wenn auch in geringerem Maße, wird das Blasenurothel (die Wand, die Blase und Harnröhre bedeckt) von hormonellen Reizen beeinflusst. Daher ist es offensichtlich, dass diese Wand dünner werden und empfindlicher werden kann, wenn der Östrogenspiegel abnimmt.
Verminderung der Döderlein-Flora: Reduzierung der Immunabwehr
Wie bereits erwähnt, ist der „Schutzschild“ der urogenitalen Sphäre bei vaginaler Dysbiose verringert.
Verminderte Immunabwehr: Erhöhtes Infektionsrisiko
In einem Kontext, in dem die physiologische Immunität der urogenitalen Sphäre verringert ist, treten sogenannte „opportunistische Infektionen“ (d. h. Infektionen durch Bakterien, die normalerweise im Perinealbereich leben, ohne ein Ungleichgewicht zu verursachen) häufiger auf. Dies umfasst auch bakterielle und Pilzinfektionen, sowohl vaginal als auch vesikal.
Erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen: Biofilm-Bildung
Bei verminderter Immunabwehr sind Bakterien und Hefen, die für opportunistische Infektionen verantwortlich sind, besser in der Lage, pathogene Biofilme zu bilden, die das Problem zunehmend anfälliger für Chronifizierung und bakterielle Resistenz machen.
Erhöhtes Risiko für „opportunistische“ Infektionen: Kontinuierliche Therapien
Das Wiederauftreten akuter Infektionsfälle erfordert zwangsläufig Antibiotika- oder Antimykotikatherapien, die aufgrund ihrer Nebenwirkungen die Döderlein-Flora, die Darmflora und folglich die Immunabwehr negativ beeinflussen und einen regelrechten „Teufelskreis“ erzeugen.
Chronische Entzündung
Die Kombination der oben genannten Mechanismen führt zu einem pro-inflammatorischen Zustand der urogenitalen Sphäre, der weiter erklärt, wie zahlreiche Fälle von Hypothyreose zu chronischen nicht-bakteriellen (dh entzündlichen) Problemen führen können.
Unter den Funktionen der Schilddrüsenhormone ist auch die Stimulation der Darmperistaltik zu nennen. Hypothyreose geht oft mit chronischer Verstopfung einher, was den Prozess der Darmdysbiose und der Darmpermeabilität begünstigt, wodurch Bakterien passieren können und folglich bakterielle Migrationen vom Darm zur Blase ermöglicht werden, ein Mechanismus, der zu wiederkehrenden Harnwegsinfektionen und der Bildung persistenter pathogener Biofilme führen kann.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Schilddrüsenerkrankungen oft mit der Prä- und Postmenopause assoziiert sind, was dazu neigt, die oben beschriebenen Prozesse zu verschlimmern und zu verstärken.
Wenn eine Verbindung zwischen Hypothyreose und Blasenentzündung hergestellt wird, ist es sinnvoll, die hier beschriebenen Ansätze zu nutzen, um die Auswirkungen des Östrogenabfalls, der bereits ab der Prämenopause auftritt, durch eine Reihe von Präventionsmaßnahmen zu reduzieren, wie zum Beispiel:
- Unterstützung des Trophismus und der Befeuchtung der Vulvovaginalschleimhaut mit Ausilium Crema;
- Unterstützung der Reepithelisierung des Blasenurothels und Wiederherstellung der GAG-Schicht mit Cistiquer und Ausilium Venus;
- Unterstützung der Döderlein-Flora mit Ausilium Lavanda und Ausilium Flora;
- Unterstützung der Immunabwehr mit Nonidea und Benefit Q;
- Bekämpfung opportunistischer Infektionen und Bildung pathogener Biofilme mit Ausilium NAC und Ausilium 20 PLUS oder Ausilium Forte;
- Reduzierung und Linderung von Entzündungen mit Cistiquer und Alaquer.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel hilfreich ist. Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, schreiben Sie an unsere Experten unter: kontakt@deakos.com.