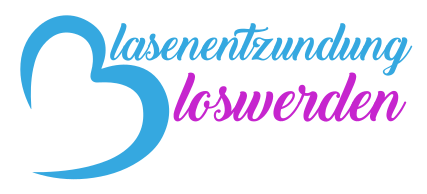Aufgrund einiger Anfragen zur Notwendigkeit der Kontrolle des Harn-pH-Werts und seiner Auswirkungen auf Blasenentzündungen findet ihr in diesem Artikel eine Zusammenfassung der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema.
Der pH-Wert ist eine Maßeinheit zur Quantifizierung der Säure einer Lösung.
Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, wobei ein Wert von 7 als neutral gilt. Werte unter 7 sind „sauer“, während Werte über 7 als „basisch“ oder „alkalisch“ bezeichnet werden.
Hinweis: Der pH-Wert eines Lebensmittels, Getränks oder Medikaments ist nicht direkt proportional zu seiner Wirkung auf den Harn-pH-Wert. Zum Beispiel ist Zitrone eine saure Frucht, wirkt sich aber alkalisch auf den Urin aus. Um die Auswirkungen eines Lebensmittels auf den Harn-pH-Wert zu kennen, sollte man sich auf die PRAL-Werte beziehen, die den „Säurebildenden Index“ angeben.
Der physiologische Gleichgewichtszustand des Harn-pH-Werts
Der Harn-pH-Wert schwankt normalerweise zwischen 4,5 und 7,5. Der Urin ist in der Regel leicht sauer, kann jedoch je nach Ernährung und individuellen Faktoren (z. B. Alter, Gesundheitszustand, physiologischer Zustand) auch alkalisch werden.
Der Harn-pH-Wert kann einfach mit Urin-Teststreifen gemessen werden, die in Apotheken und Drogerien erhältlich sind.
Hinweis: Zu basischer Urin (pH-Wert über 7,5) kann die Bildung von Nierensteinen begünstigen. Ein solch hoher Wert kann nicht allein durch die Ernährung erreicht werden. Andererseits kann ein regelmäßiger Konsum von stark säurebildenden Lebensmitteln den pH-Wert des Urins stark absenken.
Welche Rolle spielt der Harn-pH-Wert bei Blasenentzündungen?
Blasenentzündung (Zystitis) ist eine Entzündung der Blase, mit oder ohne bakterielle Infektion. Besonders bei wiederkehrender Blasenentzündung kann die Entzündung auch nach Abklingen der Infektion bestehen bleiben, was den Eindruck eines Rückfalls erweckt.
Hinweis: Deshalb ist es äußerst wichtig, bei jeder akuten Episode eine Urinanalyse und eine Urinkultur durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass kein Antibiotikum unnötig eingenommen wird.
Wenn ein Gewebe entzündet ist – insbesondere eine Schleimhaut wie die Blasenwand, die ähnlich empfindlich wie die Mundschleimhaut ist – ist es essenziell, die Entzündung zu beruhigen. Dies kann auf zwei Arten gleichzeitig erfolgen:
- Durch Substanzen, die die Regeneration des Epithels unterstützen (wie in Cistiquer enthalten).
- Durch die Vermeidung weiterer Reizungen der Schleimhaut. Niemand würde auf die Idee kommen, Orangensaft zu trinken, wenn er eine Aphte im Mund hat.
Falls die Blasenentzündung durch eine bakterielle Infektion verursacht wird, können die beteiligten Bakterien (z. B. Escherichia coli, Klebsiella, Streptokokken, Enterokokken) säureliebend oder säureresistent sein. Das bedeutet, dass sie eine saure Umgebung bevorzugen oder zumindest darin überleben können. Daher stellt eine Ansäuerung keinen Schutz vor einer bakteriellen Infektion dar.
Fazit: Sollte der Urin bei Blasenentzündungen angesäuert werden?
Die Ansäuerung des Urins (z. B. durch die Einnahme von Cranberry) ist keine Lösung, da sie:
- die Blasenschleimhaut schädigt, Schmerzen verstärkt und das Risiko für erneute Entzündungen erhöht,
- die Bakterien nicht abtötet.
Abschließend sei daran erinnert, dass nachgewiesen wurde, dass D-Mannose gegen uropathogene Bakterien wirksamer ist, wenn der Urin weniger sauer ist.
Die Formulierung von Ausilium 20 PLUS basiert auf dieser Erkenntnis und kombiniert D-Mannose mit einem harnalkalisierenden Wirkstoff, um die antibakterielle Wirkung zu verstärken und die Schmerzsymptomatik zu lindern.