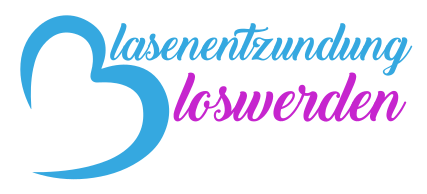Die post koitale Zystitis ist eine der häufigsten Arten bakterieller Zystitis; dennoch bleibt sie ein Tabuthema, für das es schwer ist, Informationen und Ratschläge zu finden, die über Hydratation und Hygiene hinausgehen.
Dieser Artikel bietet einen Überblick über den idealen Ansatz in dieser Situation.
Bei post koitaler Zystitis ist es entscheidend, auf allen Ebenen zu handeln, um den Teufelskreis aus neuer Infektion – Rückfall – Wiederauftreten zu durchbrechen.
Hier sind 3 mögliche Präventionsansätze:
Reibungen, die zu Mikroläsionen führen
Alle sexuellen Aktivitäten – auch die sanftesten – verursachen Reibungen, die zu Mikroläsionen der Vaginalschleimhaut führen. Diese winzigen Verletzungen schaffen einen ‚Schutzraum‘, in dem sich pathogene Bakterien ’niederlassen‘ können. So wird die Vaginalschleimhaut zu einem ‚mikrobiellen Reservoir‘, das wiederkehrende Harnwegsinfektionen durch Aufstieg oder Migration verursacht.
Daher ist es während des Geschlechtsverkehrs unerlässlich, eine vaginale Creme zu verwenden:
- Gleitmittel -> um Reibungen zu begrenzen (ohne das Vergnügen einzuschränken)
- mit D-Mannose -> um uropathogene Keime sofort zu neutralisieren, noch bevor sie Harnröhre und Blase erreichen, und um einen schützenden Film auf der Schleimhaut zu erzeugen, der verhindert, dass sich Bakterien ’niederlassen‘
- mit natürlichen entzündungshemmenden Wirkstoffen -> zur Unterstützung der Trophik und zur schnellen Heilung der Schleimhaut
Es ist ideal, diese Creme vor und nach jedem Geschlechtsverkehr anzuwenden.
Ungeschützter Geschlechtsverkehr
Ungeschützter Geschlechtsverkehr kann zu einer gegenseitigen Kontamination der Partner führen: Der Austausch kann in beide Richtungen erfolgen.
Wenn Bakterien in der Harnröhre des Partners vorhanden sind, transportieren die Prostatasekrete die Bakterien in die Vagina.
Wenn Bakterien in der Vagina vorhanden sind, können sie in die Harnröhre des Partners aufsteigen und so eine Infektion beim Mann (Harnröhrenentzündung oder Prostatitis), oft ohne Symptome, verursachen.
In beiden Fällen dient der Partner als ‚bakterielles Reservoir‘ für post koitale Infektionen, da beim Samenerguss die Bakterien im Sperma transportiert werden.
Deshalb ist es wichtig:
- Eine Urin-, Harnröhren- und Sperma-Kultur durchzuführen, um eine mögliche bakterielle Anwesenheit in den Harnwegen und der Prostata zu erkennen.
- Dem Partner die Einnahme von D-Mannose (1 g/Tag) vorzuschlagen, um einen möglichen Bakterienaustausch zwischen den Partnern zu verhindern und/oder eine mögliche bereits vorhandene bakterielle Anwesenheit zu beseitigen.
Pathogener Biofilm
Wenn eine Blasenentzündung chronisch wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ursache ein pathogener Biofilm ist – in über 80% der Fälle. Der Biofilm ist eine Strategie der Bakterien, bei der sie einen ‚Schutzschild‘ bilden, um sich zu isolieren und vor äußeren Angriffen (Leukozyten, Antibiotika und sogar D-Mannose selbst) zu schützen. Auf diese Weise persistieren uropathogene Bakterien im Biofilm, der gelegentlich geöffnet wird, um neue bakterielle Kolonien freizusetzen und eine neue Infektion zu verursachen.
Es wurde nachgewiesen, dass der Biofilm sich in der Blase, der Harnröhre und auch in der Vagina bilden kann, was ihn zu einem lokalen ‚bakteriellen Reservoir‘ macht.
Achtung: Diese Struktur ist winzig und bei routinemäßigen Untersuchungen unsichtbar. Daher ist es entscheidend, gegen den Biofilm vorzugehen durch:
- Die Einnahme von N-Acetylcystein (NAC) -> eine Aminosäure, die die Polysaccharidmatrix (äußere Schicht) des Biofilms aufbrechen kann.
- Die Einnahme von D-Mannose -> ein Zucker, der sich an Pathogene bindet, die beim Auflösen des Biofilms freigesetzt werden, um ihr pathogenes Potenzial zu reduzieren und das Auftreten eines akuten Ausbruchs zu verhindern.
Falls sich eine Blasenentzündung trotz aller Hygienemaßnahmen und oben genannter Ratschläge nach einem Geschlechtsverkehr erneut zeigt, ist es dennoch möglich, eine Antibiotikaprophylaxe zu vermeiden durch:
- Die sublinguale Einnahme einer Dosis D-Mannose (D-MannOro) nach dem Geschlechtsverkehr -> um sicherzustellen, dass D-Mannose innerhalb von 30 Minuten nach dem Geschlechtsverkehr in der Blase vorhanden ist und um die Bakterienadhäsion sofort zu ‚blockieren‘.
- Die Einnahme von D-Mannose (1 g, 2- bis 3-mal täglich) -> um eine konstante Präsenz des Wirkstoffs in den Harnwegen sicherzustellen und so die Adhäsion der uropathogenen Bakterien bei ihrer Ankunft zu hemmen.
- Die Anwendung einer vaginalen Creme vor und nach jedem Geschlechtsverkehr.
In dieser Hinsicht können weitere Maßnahmen je nach Situation hilfreich sein:
- Unterstützung der physiologischen Vaginal Flora -> Probiotika zur oralen Einnahme und lokalen Anwendung.
- Wiederauffüllung der vaginalen Schleimhaut -> Vaginalspülung mit D-Mannose und NAC.
- Unterstützung des Darmmikrobioms -> Probiotika und Präbiotika.