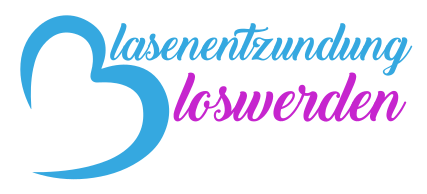In diesem Artikel schildern wir die Erfahrungen einer unserer Leserinnen, die an einer Urethritis leidet, und schlagen eine mögliche Behandlungsstrategie vor.
„Jahrelang litt ich an Blasenentzündungen, die stets mit Antibiotika behandelt wurden, da die Urinkulturen positive Ergebnisse (bakterielle Präsenz von E. coli) zeigten. Doch die verschriebene Therapie war immer wenig oder gar nicht wirksam, und die Rückfälle ließen nicht lange auf sich warten.
Außerdem verursachten die Behandlungen viele Nebenwirkungen: Pilzinfektionen, Reizungen, Verdauungsprobleme, Müdigkeit, ein geschwächtes Immunsystem. Ich bin überzeugt, dass sie auch zur Chronifizierung der Blasenentzündungen beigetragen haben.
Nach etwa drei bis vier Jahren mit verschiedenen Leiden begann ich, ein nahezu kontinuierliches Unbehagen im Unterbauch zu verspüren. Anfangs war es ein dumpfes Gefühl, das ich nur schwer identifizieren und genau lokalisieren konnte. Je mehr Zeit verging, desto stärker wurde dieses Unbehagen, das sich in ein Kribbeln verwandelte, das ständig spürbar war und sich auf den unteren Bereich der Blase und die Harnröhre konzentrierte. Wenige Monate später entwickelte sich daraus ein regelrechtes Brennen, ähnlich wie bei einem akuten Blasenentzündungsschub, aber gleichzeitig völlig anders: Ich hatte keine Schmerzen beim Wasserlassen! Im Gegenteil, das Gegenteil war der Fall: Nach dem Wasserlassen verspürte ich Erleichterung. Sobald die Blasenentleerung beendet war, kehrte der Schmerz zurück und nahm allmählich bis zum nächsten Wasserlassen zu. Mein Arzt und zwei Urologen waren nicht in der Lage, zu verstehen, worum es sich handelte. Die Urinkulturen waren inzwischen negativ geworden, und es war nur noch von einer Entzündung (oder Reizung) ohne Infektion die Rede. Ein Urologe sprach von interstitieller Zystitis, ein anderer von psychischen Problemen (!).
Schließlich fand ich nach intensiver Recherche in der englischsprachigen medizinischen Literatur einige Hinweise, die den Antworten nahe kamen. Es handelte sich schlicht und einfach um eine bakterielle Urethritis. Oft wird diese Diagnose bei Frauen von vornherein ausgeschlossen, da die Harnröhre anatomisch sehr kurz ist. Aber auch ein kleines Organ kann krank werden!
Es wird oft angenommen, dass die Bakterien, die Blasenentzündungen verursachen, sich nicht in der weiblichen Harnröhre ansiedeln können, da sie nichts haben, woran sie „haften“ können. Dies mag im Leben einer Frau mit nur einem einzigen Harnwegsinfekt zutreffen, aber bei 15 bis 20 Blasenentzündungen pro Jahr ist die Situation eine völlig andere! In diesem Fall wird die Anhaftung der pathogenen Bakterien an die Harnröhrenwand durch zwei Mechanismen begünstigt:
- Häufigerer Kontakt zwischen der Wand und den Bakterien.
- Eine verminderte Qualität und Widerstandsfähigkeit der Harnröhrenwand aufgrund chronischer Infektionen und antibiotischer Behandlungen. Diese töten zwar die Bakterien ab, verursachen aber die Freisetzung von Toxinen (die Bakterien geben sie beim Absterben frei), die eine „abrasive“ Wirkung auf die Schleimhäute von Blase und Harnröhre haben.
Und wie lassen sich die negativen Urinkulturen erklären? Ganz einfach: Beim Sammeln von Urinproben wird der erste Urinstrahl verworfen – genau derjenige, der die Bakterien aus der Harnröhre enthalten kann! Zudem macht die Fähigkeit der pathogenen Bakterien, einen Biofilm zu bilden, sie für Labortests unsichtbar.“
Was tun bei bakterieller Urethritis bei Frauen?
- Verzicht oder Mäßigung beim Einsatz von Antibiotika
Wenn eine Frau an einer bakteriellen Infektion leidet, die ausschließlich in der Harnröhre lokalisiert ist, dann hat sie wahrscheinlich bereits eine Vorgeschichte mit häufigen Harnwegs- und Vaginalinfektionen. In solchen Fällen sind Antibiotika keine zuverlässige Lösung mehr, da sie zu zunehmenden Resistenzentwicklungen der beteiligten Bakterien führen und durch Nebenwirkungen, die die physiologische Flora des Körpers beeinträchtigen, das Immunsystem schwächen. Darüber hinaus sind Antibiotika bei bakteriellen Biofilmen, die in über 60 % der Fälle vorhanden sind – und wahrscheinlich noch häufiger bei Urethritis –, völlig unwirksam.
- Andere mögliche Reizursachen der Harnröhre neben der bakteriellen reduzieren
Dazu ist es ratsam, die Urin-pH-Werte zu alkalinisieren und unbedingt auf Cranberry, Preiselbeeren und Bärentraubenblätter zu verzichten, da sie den Urin stark ansäuern. Es wird außerdem empfohlen, den Verzehr tierischer Produkte zu reduzieren: Fleisch (sowohl rotes als auch weißes), Wurstwaren, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Käse, Alkohol und fermentierte Lebensmittel (wie Brot und Pizza).
Auch Reibungen im Genital- und Vulvabereich sollten vermieden werden: Weite Kleidung tragen, bequeme Baumwollunterwäsche (möglichst weiß, aus Baumwolle oder Seide), vor und nach dem Geschlechtsverkehr Ausilium Creme verwenden und auf Fahrradfahren, Reiten und Spinning verzichten.
- Den bakteriellen Biofilm und uropathogene Bakterien beseitigen
Der effektivste Weg, um den Bakterien den Schutzschild des Biofilms zu nehmen, besteht darin, diesen mit einem Wirkstoff wie N-Acetylcystein in Kontakt zu bringen, um ihn aufzulösen. Die freigesetzten Bakterien können dann durch D-Mannose eliminiert werden, die sie daran hindert, sich an die Schleimhaut anzuheften, und sie mit dem Urinfluss aus dem Körper transportiert.
Achtung: Damit diese Abfolge korrekt abläuft, müssen die genannten Wirkstoffe in der Blase – und somit in der Harnröhre – in einem einzigen Nahrungsergänzungsmittel vereint sein. Sie in verschiedenen Formen oder getrennt einzunehmen, könnte den Prozess umkehren und die Wirkung der D-Mannose zunichtemachen oder sogar verschlechtern, da die große Menge an freigesetzten Bakterien leicht die Schleimhaut besiedeln könnte.
- D-Mannose und Harnröhre: Wie kann die Wirkung der D-Mannose in der Harnröhre verbessert werden?
MIM-Methode
Die manuelle Unterbrechungsmethode (MIM) ist ein manueller Vorgang, der die Kontaktzeit eines durch den Urin transportierten Wirkstoffs (in diesem Fall D-Mannose) mit der Schleimhaut des Harnröhrenkanals verlängert.